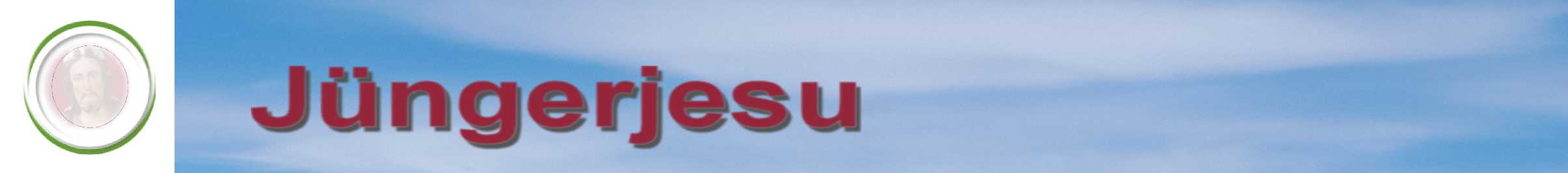Warum feiern wir überhaupt sonntags oder auch Werktags die Heilige Messe?
Beim letzten Abendmahl hat Jesus mit seinen Aposteln das Brot und Wein geteilt. Das Brot als Symbol für seinen Leib und den Wein für sein Blut. Dann hat er zu ihnen gesagt: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. Wir sollen seine Gegenwart feiern. Wir dürfen große Freude daran haben, dass er unsichtbar immer bei uns ist. Jeden Tag bei jedem Menschen und am Sonntag in der Gemeinde bei der heiligen Messe.
Weil wir das glauben, feiern wir die Heilige Messe.
Jede Feier braucht eine gute Vorbereitung, die in der Heiligen Messe auf das Mahl mit Jesus wichtiger Bestandteil ist.
Der äußere Rahmen ist der Ort in der Kirche. Außerdem gehört festliche Kleidung dazu. Niemand geht doch zu einer Feier mit seinen Alltagsklamotten (heutzutage machen das aber dennoch einige). Aber besonders die Diener am Altar – also der Priester und die Ministranten tragen farbige Gewänder in Anlehnung der damals übliche Kleidung.
Mit einem Klingelzeichen betreten die Altardiener den Kirchenraum. Die Ministranten gehen voran. Der Priester geht als erstes zum Altar und küsst ihn als Zeichen der Liebe. Der Altar ist der Ort, wo Christi Opfer für die Menschen gegenwärtig wird. Auch ganz zum Schluss küsst der Priester den Altar.
Die ersten Worte des Priesters sind: „Der Herr sei mit euch!“
Wir glauben, dass Gott schon längst da ist. Mit diesen Worten wird seine Gegenwart nochmal ausdrücklich betont. Denn Jesus selbst hat ja gesagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“
Zahlenmäßig kommt das immer hin.
Bevor wir nun die Feier wirklich beginnen können, müssen wir um Vergebung unserer Sünden bitten, damit wir reinen Herzens feiern können. Das geschieht im Schuldbekenntnis. Das betrifft die kleinen Sünden. Für große Sünden wäre die Heilige Beichte notwendig. Es kann also niemand meinen er sei rein alleine durch dieses Schuldbekenntnis.
„Herr, erbarme dich!“, so spricht die Gemeinde gemeinsam.
Voller Jubel und Freude über die gerade empfangene Vergebung dürfen wir laut rufen: „Ehre sei Gott in der Höhe!“
Wenn danach der Priester das Tagesgebet vorliest, werden auch wir aufgerufen, jetzt zu beten. Das geschieht mit den Worten: „Lasset uns beten!“
Im Tagesgebet betet der Priester stellvertretend für uns alle und wir erwidern am Schluss: „Amen“. Das bedeutet, ja, das glauben wir. Bei diesem Gebet öffnet er weit die Arme nach oben als Zeichen für Offenheit und Ergebenheit gegenüber Gott. Auch zu verstehen als Bitte um Füllung der leeren Hände.
Erhobene Hände waren schon zu Zeiten von Mose ein Zeichen für die Verbundenheit mit Gott. Solange Mose die Hände erhoben hatte, war Gottes Volk siegreich.
Die Texte der Lesungen und des Evangeliums sind Worte Gottes aus der Bibel. Gott spricht zu uns. Er spricht jeden Einzelnen von uns direkt an. Der Höhepunkt ist das Evangelium, durch das Jesus selbst zu uns spricht. Deshalb darf es nur vom Priester oder Diakon vorgetragen werden. Gottes Wort hat immer tiefere Bedeutung. Seine Worte sind nicht nur so daher geredet. Seine Worte sind Licht und Wahrheit.
Nach der Predigt spricht die Gemeinde das Glaubensbekenntnis. Wir bekennen klar und deutlich unseren Glauben. Das Besondere an diesem Gebet ist, dass wir um nichts bitten, sondern detailliert sagen, dass und was wir glauben. Besonders ist auch, dass wir es gemeinsam beten. Keiner ist mit seinem Glauben alleine. Als Gemeinschaft bekennen wir uns zu unserem Gott. Durch das Glaubensbekenntnis dürfen wir uns auch mit allen anderen Katholiken verbunden fühlen.
Formuliert wurde es einer Legende nach von den Aposteln nach dem Pfingstfest. Durch den Heiligen Geist erfüllt riefen sie es aus, bevor sie sich trennten, um Jesu Botschaft zu verkünden.
Natürlich dürfen wir Gott auch all unsere Bitten vorbringen. Gott möchte uns beschenken. Wir können ihm all unsere Nöte und Sorgen dieser Welt anvertrauen mit der Hoffnung, ja mit der Gewissheit, dass er sie auch erfüllt. Dabei dürfen wir auch ein wenig mutig sein. Wir bitten ja nur. Wir fordern nichts. Gott weiß ohnehin, was wir brauchen. Aber er möchte es von uns hören. Mit unserer Fürbitte öffnen wir ihm ja auch unser Herz. Dass wir keine unsinnigen Bitten vorbringen, versteht sich von selbst.
Mit der Gabenbereitung beginnt die eigentliche Eucharistie. Brot und Wein werden zum Altar gebracht. Beides symbolisiert unser Geschenk an Gott.
Eigentlich will Gott von uns keine Opfer. Er hat sich ja selbst zum Opfer gemacht, in dem er seinen einzigen Sohn für uns hingab. Wir können Gott ja gar nichts opfern, das ihm angemessen wäre. In der Eucharistie feiern wir deshalb sein Opfer als das Geheimnis des Glaubens. Das eigentliche Opfer, das Gott von uns will, ist doch unser Herz. Er will unseren Dank, unsere Probleme, Sorgen und Hingabe. Auf dem Altar wird unser kleines Opfer gewandelt und wertvoll.
„Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. “ Antwort: „Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche.“
Jetzt hat der Herr das Opfer angenommen. Voller Freude singen wir zu seiner Ehre das Heilig, heilig, heilig. Dreimal als Zeichen der Dreifaltigkeit. Es fühlt sich beinahe so an, als wären wir selbst in dem Moment im Himmel. Denn wo Gott ist, da ist der Himmel.
Bei der heiligen Wandlung wird nun Brot zum Leib Christi und Wein zu seinem Blut. Jesus wird durch die Wandlung für uns gegenwärtig. Der Priester zeigt jeweils Brot und Wein hoch und sagte stellvertretend für Jesus: „Das ist mein Leib, das ist mein Blut!“
Der geweihte Priester ist der Stellvertreter Jesu auf der Erde und darf in seinem Namen diese Wandlung mit den Worten: „Tut dies zu meinem Gedächtnis“, vollziehen.
Nach der Wandlung folgt das Hochgebet. Dabei kniet die Gemeinde. Das Hochgebet ist ein Fürbittgebet für die Kirche, den Papst, Bischof, alle die der Kirche dienen, sowie für die Lebenden und Verstorbenen.
Es folgt das „Vater unser“, durch das wir wieder unseren Glauben bezeugen.
Die Heilige Eucharistie ist deshalb auch so wunderbar, weil sie uns echte Gemeinschaft mit Jesus ermöglicht. Der Friedensgruß stammt daher, weil Jesus seinen Jüngern damals zugerufen hat: „Der Friede sei mit euch! Schalom aleikem!“(Joh 19,19,21)
Es geht nicht nur um den Frieden in unserer menschlichen Gemeinschaft, sondern auch um den Frieden, den jeder Einzelne mit Gott haben sollte.
Der Friedensgruß hat seinen Platz direkt vor der Kommunion. Er könnte aber auch an anderer Stelle der Heiligen Messe erfolgen.
Dann geht die Gemeinde zur Heiligen Kommunion. Das heißt auch „Gemeinschaft“. Durch den Empfang der Oblate erhalten wir geistige Gemeinschaft mit Gott. Diese Gemeinschaft können wir haben, weil Gott es so will – weil er uns so sehr liebt. Beim Empfang der heiligen Kommunion sollten wir uns dessen voll bewusst sein. Denn ohne Gemeinschaft mit Gott können wir nicht leben. Es soll uns Stärkung sein für den Glauben. Und der Glaube wiederum sollte sehr bewusster Bestandteil bei all unseren alltäglichen Aufgaben und Sorgen sein, nicht zuletzt natürlich beim Feiern der Heiligen Eucharistie.
Zur Erinnerung an dieses bewusste Teilhaben an der Kommunion hebt der Priester vorher die Hostie mit den Worten: „Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.“ Demütig antworten wir: „Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund.“
Nach der Kommunion singen wir noch ein Danklied. Der Priester betet noch ein Dankgebet und ruft uns zu: „Gehet hin in Frieden!“, und wir antworten: „Dank sei Gott dem Herrn!“ Es folgt das Schlusslied.
Gehet hin in Frieden sollte eigentlich ein Aufruf zur Sendung sein. Wir haben alle den Auftrag, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen.
Für diese Ausführungen habe ich einen mehrteiligen Artikel von Pater Karl Wallner als Anregung und Grundlage genutzt, der in den Vermeldungen von 2016 bis 2017 über die Eucharistie stand und hier mit eigenen Worten formuliert.